Pathophysiologie der Depression, Risikoprognose für ein erneutes Auftreten und komorbide psychiatrische Störungen anhand genomweiter Analysen
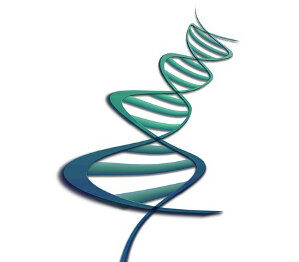
29.08.2023 Eine neue Studie der Universität Aarhus zeigt, dass das genetische Risiko für Depressionen mit einem erhöhten genetischen Risiko für andere psychiatrische Diagnosen verbunden sein kann. Die Studie wurde in Nature Medicine veröffentlicht.
Mittels eines detaillierten genetischen Scans untersuchten die Forscher das Genom von 1,3 Millionen Menschen, von denen mehr als 370.000 an Depressionen litten. Es handelt sich um die bisher größte genetische Studie zu Depressionen, und sie zeigt, dass Menschen mit stationär behandelten Depressionen häufig ein höheres Risiko haben, Erkrankungen wie Drogensucht, bipolare Störungen, Schizophrenie und Angststörungen zu entwickeln, und dass es möglich ist, das Risiko für die Entwicklung dieser psychiatrischen Störungen anhand von Genanalysen vorherzusagen.
Bipolare Störung, Schizophrenie, Drogensucht
Die Studie zeigt beispielsweise, dass Menschen mit einer im Krankenhaus behandelten Depression und einer hohen genetischen Veranlagung für eine bipolare Störung ein 32-mal höheres Risiko haben, diese Krankheit zu entwickeln, als der Rest der Allgemeinbevölkerung.
Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Schizophrenie bei Personen mit einer im Krankenhaus behandelten Depression und einer hohen genetischen Veranlagung für Schizophrenie 14-mal höher als in der übrigen Bevölkerung.
Die Studie zeigt, dass Menschen mit einer im Krankenhaus behandelten Depression und einer hohen genetischen Veranlagung für Drogenmissbrauch ein 21-prozentiges Risiko haben, ein schweres Drogenmissbrauchsproblem zu entwickeln. Dies ist mehr als fünfmal so hoch wie bei der Gruppe mit einer geringen genetischen Veranlagung zum Drogenmissbrauch, die ebenfalls eine Depression hatte. Und es ist zehnmal höher als bei der Allgemeinbevölkerung ohne stationär behandelte Depression. Diese Gruppe hat nur ein 2-prozentiges Risiko, dass im gleichen Zeitraum ein Substanzmissbrauch diagnostiziert wird.
Negative Auswirkungen auf die Gehirnfunktion und das Bildungsniveau eines Menschen
In der Studie fanden die Forscher zahlreiche neue genetische Risikovarianten und Risikogene für Depressionen. Diese liefern neue Erkenntnisse über die beteiligten biologischen Krankheitsmechanismen und weisen auf neue molekulare Ziele für die Behandlung hin.
“Wir haben eine Reihe von biologischen Systemen und Zelltypen gefunden, die von dem genetischen Risiko betroffen sind. Die Auswirkungen zeigen sich in praktisch allen Regionen des Gehirns, nicht aber in anderen Organen. Und zwar hauptsächlich in den Nervenzellen des Gehirns – den Neuronen”, sagt Studienautor Thomas Als.
“Das genetische Risiko kann viele verschiedene Arten von Neuronen betreffen. Insgesamt kann man sagen, dass das genetische Risiko die Entwicklung und Kommunikation der Gehirnzellen beeinflusst”, sagt Thomas Als.
Die Studie zeigt, dass insgesamt 11.700 genetische Risikovarianten 90 Prozent der Vererbbarkeit von Depressionen erklären können, was Depressionen zu einer der komplexesten und polygensten psychischen Störungen macht. Die Mehrzahl der Risikogene muss noch identifiziert werden.
Die Forscher haben herausgefunden, dass praktisch alle der 11.700 genetischen Risikovarianten für Depressionen auch einen Einfluss auf das Bildungsniveau der Allgemeinbevölkerung haben. Einige Risikovarianten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen, während andere die Wahrscheinlichkeit verringern. Insgesamt verringern die genetischen Varianten jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine höhere Ausbildung abschließt.
“In Übereinstimmung damit haben wir festgestellt, dass das genetische Risiko für Depressionen mit verminderten kognitiven Eigenschaften in der Bevölkerung verbunden ist. Dies betrifft insbesondere abstraktes Denken und geistige Flexibilität, Aufmerksamkeit und sprachliches Denken”, erklärt Koautor Anders Børglum.
Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass der Keim der Krankheit bereits im Embryonalstadium gelegt wird.
“Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass ein Teil des genetischen Risikos bereits im Embryonalstadium die Gehirnzellen beeinflusst und dass Depression in gewissem Maße eine neuronale Entwicklungsstörung ist”, sagt Børglum:
“Dies deckt sich mit der Tatsache, dass wir eine erhebliche genetische Überschneidung zwischen Depressionen und beispielsweise Autismus und ADHS feststellen.”
© Psylex.de – Quellenangabe: Nat Med 29, 1832–1844 (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02352-1
